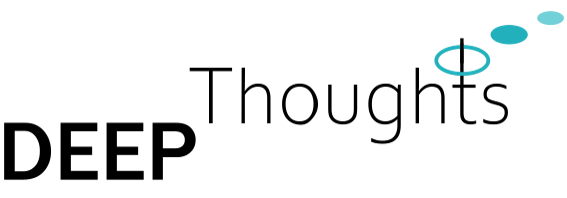📌 Allgemeine Hinweise
Bisociation ist ein kreatives Denkwerkzeug, das zwei ehemals getrennte Wissens- oder Bedeutungsräume (Frames, Domänen, Kontexte) miteinander verbindet, um neue Einsichten, Ideen oder Problemlösungen zu erzeugen. Anders als einfache Assoziation zielt Bisociation auf das gleichzeitige Denken in zwei (oder mehr) Bezugsrahmen, wobei die „Lücke“ zwischen ihnen fruchtbar gemacht wird. Ziel ist es, mentale Gewohnheiten zu durchbrechen und neue Ideen zu entwickeln.
Bisociation erzeugt oft ungewöhnliche Kombinationen — nicht alle sind nützlich. Das Werkzeug verlangt systematisches Dokumentieren, kritische Bewertung und Iteration, damit flüchtige Eingebungen in organisational nutzbares Wissen überführt werden.
🎯 Bestimmungsgemäße Verwendung
Bisotiation wird eingesetzt, zur:
- Generierung neuartiger Ideen und Konzepte (Produktinnovation, Service-Design, Prozessinnovation).
- Identifikation verborgener Wissensverbindungen zwischen Abteilungen, Domänen oder Projekten.
- Förderung von kreativer Problemlösung in interdisziplinären Teams.
- Entdeckung von Transferpotenzial bereits vorhandenem Know-how für neue Anwendungsfelder.
- Unterstützung beim Wissenstransfer: explizite Verknüpfung von implizitem Wissen aus verschiedenen Kontexten.
ℹ️ Hintergrundinformationen zu dem Werkzeug
„Bisotiation“ ist ein hybrides Konzept, das Elemente der „Bilateral Negotiation“ und „Collaboration“ kombiniert. Der Begriff und das Konzept wurden vor allem durch Arthur Koestler („bisociation“) und die Forschung zur Kreativität geprägt. Es folgt dem Grundprinzip, das Neues nicht nur durch Variation innerhalb eines Rahmens entsteht, sondern durch Verschränkung unterschiedlicher Rahmungen. Im Organisationskontext hilft Bisociation dabei, Silos aufzubrechen. Bisociation ist methodisch verwandt mit Konzepten wie Concept Blending, Analogiebildung und Cross-Domain Mapping, unterscheidet sich aber durch die Betonung der gleichzeitigen Präsenz beider Frames.
Im Wissensmanagement hilft die Methode, neues Wissen und Ideen zu generieren, indem man Blickwinkel aus verschiedenen Disziplinen oder Bereichen zusammenführt.
🔁 Welche Werkzeuge alternativ verwendet werden können
- Analogiebildung (systematische Übertragung von Lösungen aus einer Domäne in eine andere).
- Design Thinking (Nutzerzentrierung, Empathie → Ideen → Prototypen).
- TRIZ (systematische Innovationsprinzipien aus technischen Widersprüchen).
- Morphologischer Kasten (systematische Kombination von Merkmalen).
- Laterales Denken / Lateral Thinking nach De Bono und Brainstorming-Varianten.
Hinweis: Diese Methoden sind nicht unbedingt Ersatz — sie ergänzen Bisociation häufig gut.
🔧 Welche anderen Werkzeuge unterstützen können
- Wissensdatenbanken / Ontologien / Taxonomien — schnell relevante Konzepte aus verschiedenen Bereichen abrufen.
- Semantische Netzwerke / Concept Maps — Visualisierung der Frames und Schnittmengen.
- Text-Mining / Topic Modeling / Embeddings — automatische Identifikation thematischer Schnittpunkte in großen Dokumentenkorpora.
- Collaborative Whiteboards (Miro, MURAL) — für visuelle Verknüpfung und Gruppenarbeit.
- Morphologische Kästen, SCAMPER-Listen, Forced-Connection-Karten — als Mechaniken zur Anregung von Bisociation.
- Prototyping-Materialien — um Bisociation-Ideen schnell greifbar zu machen (Proof of Concept).
👥 Benötigte Personen
- Moderation / Facilitation: leitet Prozess, schützt divergente Phasen, dokumentiert.
- Interdisziplinäres Team: 4–8 Personen aus mindestens zwei unterschiedlichen Domänen (z. B. Produktion + Marketing, IT + Customer Service).
- Dokumentation / Wissensmanager (optional): strukturiert Ergebnisse, pflegt Wissensbasis.
- Optional: Datenanalyst (bei Einsatz text-mining), Fachexperten aus weiteren Domänen.
⏱️ Dauer
- Kurzformat (Inspiration/Impulse): 1–3 Stunden — schnelle Forced-Connections, Ideensammlung.
- Workshop (erster Zyklus): 1 Tag — Frames identifizieren, erste Bisociations generieren, priorisieren.
- Projektzyklus (Von Idee zu Pilot): 2–8 Wochen — vertiefte Recherche, Prototyping, Evaluation.
- Langfristig: Bisociation als kontinuierliche Praxis in Innovationsprozessen (laufende Inter-Domain-Reviews, Communities of Practice).
🗂️ Benötigtes Material
- Physisch: Flipcharts, Haftnotizen, Moderationskarten, Stifte, Timer, Prototyping-Kits.
- Digital: Whiteboard, Dokumentenablage/Wiki, Concept-Map-Tool, ggf. Text-Mining/Embedding-Tool.
🧩 Gerätebeschreibung / Bauplan
Bisoziation aus den folgenden Schritten:
- Problemstellung klären
- Ermittlung eines „fremden“ Betrachtungsfelds
- Verbindung der beiden Denkfelder
- Generierung und Sammlung ungewöhnlicher Ideen
- Bewertung und Auswahl sinnvoller Ansätze
🚀 Inbetriebnahme
- Ziel festsetzen: Definiere die Ziele der „Bisotiation“.
- Teilnehmerauswahl: Lege Moderation und Teilnehmendengruppe fest.
- Planung: Plane Agenda und Zeitrahmen.
- Einführung: Die Moderation erklärt Methode und Ziel.
⚙️ Bedienung
- Problemdefinition: Welches Problem oder welches Ziel steht im Fokus (z. B. „Onboarding verbessern“, „Ausschuss verringern“)?
- Bezugsrahmen festlegen: Bestimme einen fremden Bezugsrahmen (z. B. aus anderer Branche oder Disziplin)
- Assoziationen bilden: Ermittle analogische oder metaphorische Verbindungen zwischen Problem und Bezugsrahmen
- Ideengenerierung: Sammele alle gefundenen Ideen und Lösungsvorschläge.
- Entwicklung von Lösungsansätzen: Diskutieret, filtert und entwickelt vielversprechende Lösungsansätze weiter.
🔄️ Wartung & Pflege
- Nach der Sitzung: Reflexion, welche Verbindungen besonders fruchtbar waren.
- Feedback: Rückmeldungen zur Verbesserung des Prozesses zu sammeln
- Wiederholungen: Regelmäßige Übung und Anwendung, um methodische Sicherheit zu gewinnen.
🌟 Expertentipps
- Diversity first: Je unterschiedlicher die Bezugsrahmen und die Teammitglieder, desto höher das Potenzial für fruchtbare Bisociation.
- Visualisierung: Nutze Visualisierung, um Verknüpfungen besser zu erkennen
- Kontext dokumentieren: Notiere nicht nur die Verbindung, sondern auch die Kontextbedingungen
- Aktive Teilnahme fördern: Achten Sie darauf, dass alle Stimmen gehört werden.
📝 Beispiel
Kontext:
Ein Unternehmen aus der Verpackungsindustrie möchte die Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit seiner Verpackungen verbessern, steht aber vor der Herausforderung, bestehende Materialien und Verfahren kritisch zu hinterfragen und innovative Lösungen zu finden.
Schritt 1: Problemstellung
- „Wie können wir unsere Verpackungen robuster und gleichzeitig umweltfreundlicher gestalten, ohne die Produktionskosten stark zu erhöhen?“
Schritt 2: Auswahl eines externen Bezugsrahmens
Die Gruppe entscheidet sich, sich von einer ganz anderen Disziplin inspirieren zu lassen: der Architektur – genauer: den Prinzipien nachhaltigen Bauens und der Nutzung natürlicher Materialien.
Schritt 3: Verbindung der Denkfelder (Bisoziation)
- Die Gruppe analysiert, wie Architekten natürliche Materialien wie Holz, Lehm oder recycelte Stoffe zur Dämmung und Stabilisierung nutzen.
- Sie betrachten Konzepte wie modulare Bauweise und Mehrzwecknutzung von Baustoffen.
- Parallelen werden gezogen: Kann die modulare Struktur einer Wand auf Verpackungskomponenten übertragen werden?
- Die Haptik und Beschaffenheit natürlicher Baustoffe wird übertragen auf die Frage einer haptisch guten und recyclebaren Verpackungsoberfläche.
Schritt 4: Ideenfindung
- Entwicklung eines modulares Verpackungssystems, das aus wiederverwendbaren, natürlichen „Bausteinen“ zusammengesetzt ist.
- Verwendung von Pilz-Mycel als biologisch abbaubares, gleichzeitig robustes Material (inspiriert durch nachhaltiges Bauen und Biotechnologie).
- Verpackungen, die sich ähnlich wie Häuser auf vielfältige Weise anpassen und erweitern lassen.
Schritt 5: Bewertung und Auswahl
- Pilotversuche mit Mycel-Verpackungen werden als vielversprechend eingestuft.
- Prototypen mit modularer Struktur werden weiter verfolgt.
- Eine engere Zusammenarbeit mit Architekten und Materialwissenschaftlern wird angestrebt.
Fazit
Durch die bewusste Verknüpfung der Verpackungsproblematik mit den Prinzipien nachhaltiger Architektur erschließt die Organisation neue Lösungswege, die vorher nicht sichtbar oder naheliegend waren. Die Bisoziation half, Denkbarrieren aufzubrechen und das Innovationspotenzial zu steigern.