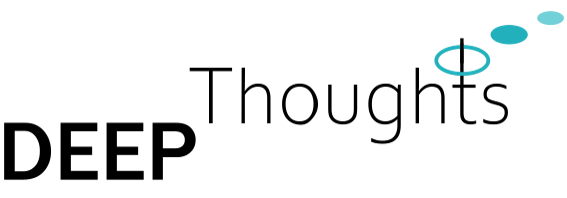📌 Allgemeine Hinweise
Die Synektik ist eine kreative Problemlösungs- und Innovationstechnik, die darauf abzielt, durch gezielte Verfremdung und Analogiebildung neue Ideen und Lösungsansätze zu erzeugen. Der Begriff stammt aus dem Griechischen („synechein“ = zusammenführen) und bedeutet das Verknüpfen von scheinbar nicht zusammengehörigen Elementen. Entwickelt wurde sie von William J. J. Gordon in den 1940er Jahren.
Im Wissensmanagement dient sie dazu, vertrautes Wissen aus einem Bereich auf neue, unbekannte Problemfelder zu übertragen.
🎯 Bestimmungsgemäße Verwendung
Synektik wird eingesetzt, zur:
- Entwicklung innovativer Lösungen durch analoge Denkprozesse
- Förderung kreativer, interdisziplinärer Lösungsansätze in Teams oder Organisationen.
- Erzeugung neuer Perspektiven auf bekannte Probleme.
- Übertragung von Problemlösungen aus anderen Bereichen (Natur, Technik, sozialer Kontext) auf ein Wissensproblem.
- Unterstützung von interdisziplinären Teams bei Wissensintegration
ℹ️ Hintergrundinformationen zu dem Werkzeug
Synektik basiert auf der Annahme, dass kreative Denkprozesse vor allem durch Assoziationen, Analogien und Transfers befördert werden. Dadurch wird die Denkweise der Teilnehmenden bewusst von der gewohnten Betrachtung eines Problems entfremdet. Dies öffnet den Blick auf neue Lösungskombinationen, die sich bei der Rückführung zur Ausgangsfrage als innovativ und praktikabel erweisen.
Der Leitspruch der Methode lautet: „Mache dir das Fremde vertraut und verfremde das Vertraute.“
Typische Prinzipien:
- Direkte Analogie: Vergleich mit etwas Ähnlichem („Ein Wissensnetzwerk funktioniert wie ein neuronales Netzwerk im Gehirn“).
- Persönliche Analogie: Sich in das Problem hineinversetzen („Wie würde ich mich fühlen, wenn ich die Wissensdatenbank wäre?“).
- Symbolische Analogie: Nutzung bildhafter Sprache („Unser Wissen fließt wie Wasser – aber wo entstehen Staudämme?“).
- Fantastische Analogie: Völlig freie, imaginäre Vergleiche („Was wäre, wenn Wissen wachsen könnte wie Pflanzen?“).
🔁 Welche Werkzeuge alternativ verwendet werden können
- Brainstorming: generiert ebenfalls kreative Ideen, jedoch weniger strukturiert.
- Morphologischer Kasten: systematische Kombination von Parametern.
- TRIZ-Methode: Erfindungsmusteranalyse (technisch orientiert).
- Bionik: nutzt biologische Analogien (spezialisierte Form der Synektik).
🔧 Welche anderen Werkzeuge unterstützen können
- Mindmapping: zur Visualisierung der Analogien und Ideen.
- Storytelling: zur narrativen Darstellung neuer Wissenskonzepte.
- Design Thinking: zur Umsetzung der durch Synektik erzeugten Ideen in Prototypen.
- Wissenslandkarten: zur Integration der neuen Analogien in bestehende Wissensstrukturen.
👥 Benötigte Personen
- Moderation (Synektik-Coach): führt die Gruppe durch die Phasen der Analogiearbeit.
- 4–8 Teilnehmende: aus unterschiedlichen Wissensbereichen (interdisziplinär).
- Protokollant: dokumentiert Ideen, Analogien und Ergebnisse.
⏱️ Dauer
- Kurze Synektik-Session: 90 Minuten
- Detaillierter Workshop: ½ Tag bis 1 Tag
- Für komplexe Themen: mehrere Sitzungen über Wochen möglich
🗂️ Benötigtes Material
- Flipchart oder Whiteboard
- Karten, Stifte, Haftnotizen
- Visualisierungsmaterial (Symbole, Bilder, Gegenstände)
- ggf. digitale Tools wie Miro, Conceptboard oder MindManager
- Kreative Hilfsmittel (z. B. Metaphernbilder, Lego, Naturmaterialien)
🧩 Gerätebeschreibung / Bauplan
Das Werkzeug besteht aus vier Hauptkomponenten, die wie ein „Kreativmotor“ zusammenwirken:
- Problemdefinition:
Klärung des Wissensproblems („Wie können wir Wissen zwischen Teams besser teilen?“). - Verfremdung:
Das Problem wird symbolisch oder bildhaft dargestellt („Wissen fließt, aber manchmal staut es sich“). - Analogiearbeit:
Suche nach Analogien aus anderen Bereichen: Natur, Technik, Alltag, Kunst usw.
→ „Wie löst ein Flusssystem Stauprobleme?“ - Rückübertragung:
Übertragung der Analogie-Erkenntnisse zurück auf das eigentliche Problem.
→ „Vielleicht brauchen wir mehr natürliche Abzweigungen – also Wissenspfade für spezielle Gruppen.“
🚀 Inbetriebnahme
- Team vorbereiten: Ziel, Problemstellung und Methode erklären.
- Aufwärmphase: Spielerische Übungen, um kreatives Denken zu aktivieren.
- Problem formulieren: kurz, präzise, offen.
- Analogiephase: Moderation führt durch verschiedene Analogieformen.
- Diskussion & Rückübersetzung: Ideen auf das Ausgangs-Problem übertragen.
⚙️ Bedienung
- Starte mit einem realen Problem.
- Wähle eine passende Analogieform. (z. B. „Wie löst die Natur dieses Problem?“)
- Sammle Analogien. – Jede noch so verrückte Idee ist erlaubt.
- Finde Muster oder Prinzipien.
- Übertrage diese auf das reale System.
- Diskutiere, wie die neuen Einsichten praktisch nutzbar sind.
🔄️ Wartung & Pflege
- Dokumentation: Ergebnisse dokumentieren und in Wissenssystem einpflegen.
- Nach einigen Wochen Reflexion: Welche Analogien waren besonders wertvoll?
- Erfolgreiche Analogien in einen internen „Synektik-Katalog“ aufnehmen.
- Wiederholungen: Methode regelmäßig trainieren.
🌟 Expertentipps
- Arbeite mit starken Bildern: Sie erleichtern die Übertragung von Wissen.
- Erlaube Unlogik: Je absurder eine Analogie, desto größer oft der Erkenntnisgewinn.
- Kombiniere Analogieformen: z. B. Fantastische + Direkte Analogie.
- Dokumentiere den Denkweg: Nicht nur die Ergebnisse sind wichtig, sondern auch, wie sie entstanden sind.
- Visualisierung: Nutze visuelle Hilfsmittel, um die Ideen während des Prozesses festzuhalten.
- Nutze Synektik besonders, wenn klassische Methoden keine neuen Ideen bringen.
📝 Beispiele
Beispiel 1: Wissensdatenbanken nutzen
Ausgangsproblem:
Das Unternehmen hat eine zentrale Wissensdatenbank, die kaum genutzt wird.
Frage: Wie kann das Wissen wieder „zum Leben erweckt“ werden?
1. Problemdefinition:
„Unser Wissen liegt brach – es wird kaum geteilt oder genutzt.“
2. Verfremdung:
Das Wissen wird als „schlafender See“ beschrieben.
3. Analogiearbeit:
- Direkte Analogie: „Wie bleibt Wasser in Bewegung?“ → durch Zuflüsse und Abflüsse.
- Persönliche Analogie: „Wie fühlt sich Wissen an, das eingeschlossen ist?“ → nutzlos, vergessen.
- Fantastische Analogie: „Was wäre, wenn Wissen Flügel hätte?“ → es könnte selbst dorthin fliegen, wo es gebraucht wird.
4. Rückübertragung:
- Neues Konzept: Einführung eines Wissensfluss-Systems mit „Wissensströmen“ (Feeds, Empfehlungen).
- Einrichtung einer automatischen Themenvernetzung („Wissen fliegt zu dir“).
- Einführung einer „Wissensbotschafter-Rolle“, die das Wissen verteilt.
Ergebnis:
Ein lebendiges, dynamisches Wissenssystem inspiriert von natürlichen Fließsystemen.
Beispiel 2: Aufbrechen von Wissens-Silos
Ausgangsproblem:
Ein internationales Unternehmen hat Probleme, Wissen zwischen verschiedenen Standorten auszutauschen.
Die Mitarbeiter speichern Wissen lokal ab, es fehlt an übergreifender Transparenz und Verbindung der Themen.
Frage:
Wie können wir den Wissenstransfer zwischen Standorten vereinfachen und lebendiger gestalten?
1. Problemdefinition
„Wissen bleibt in einzelnen Abteilungen stecken – wir haben Silos statt Austausch.“
2. Verfremdung (symbolische Darstellung):
Das Problem wird technisch und kulturell umgedeutet:
„Unser Wissenssystem funktioniert wie ein altes Telefonsystem mit manuellen Schaltern – man muss jeden Kontakt einzeln verbinden.“
3. Analogiearbeit:
Nun werden Analogien aus anderen, nicht-biologischen Bereichen gesucht:
Technische Analogie:
„Wie löst ein modernes Kommunikationsnetz das Verbindungsproblem?“
→ Durch automatische Router, die Datenpakete dorthin leiten, wo sie gebraucht werden.
Kulturelle Analogie:
„Wie arbeiten internationale Filmproduktionen effizient zusammen?“
→ Sie nutzen gemeinsame Drehbücher (Wissensbasis), Cloud-Dienste (Datenplattformen) und klare Rollen (Wissensverantwortliche).
Alltagsanalogie:
„Wie organisieren Menschen ein Klassentreffen?“
→ Über Chatgruppen, in denen Informationen offen geteilt und aktualisiert werden.
4. Rückübertragung auf das Wissensmanagement:
- Technisches Prinzip:
Einführung einer intelligenten Wissensrouter-Funktion im Intranet, die automatisch verwandte Themen, Projekte und Experten miteinander verknüpft. - Kulturelles Prinzip:
Einrichtung eines gemeinsamen „Wissensdrehbuchs“ – ein standardisiertes Template für Projektwissen, das von allen Teams genutzt wird. - Soziales Prinzip:
Aufbau von Themen-Communities in Chat-Formaten, um informellen Austausch zu fördern.
5. Ergebnis
Durch den Transfer technischer und kultureller Prinzipien entsteht ein neues System:
Ein „Wissensnetzwerk mit Routing-Funktion“, das Wissen dynamisch verteilt, ohne auf natürliche oder biologische Prozesse Bezug zu nehmen.
Das Unternehmen kann nun:
- Wissenssilos aufbrechen,
- Experten automatisch identifizieren,
- und redundante Datenspeicherung vermeiden.